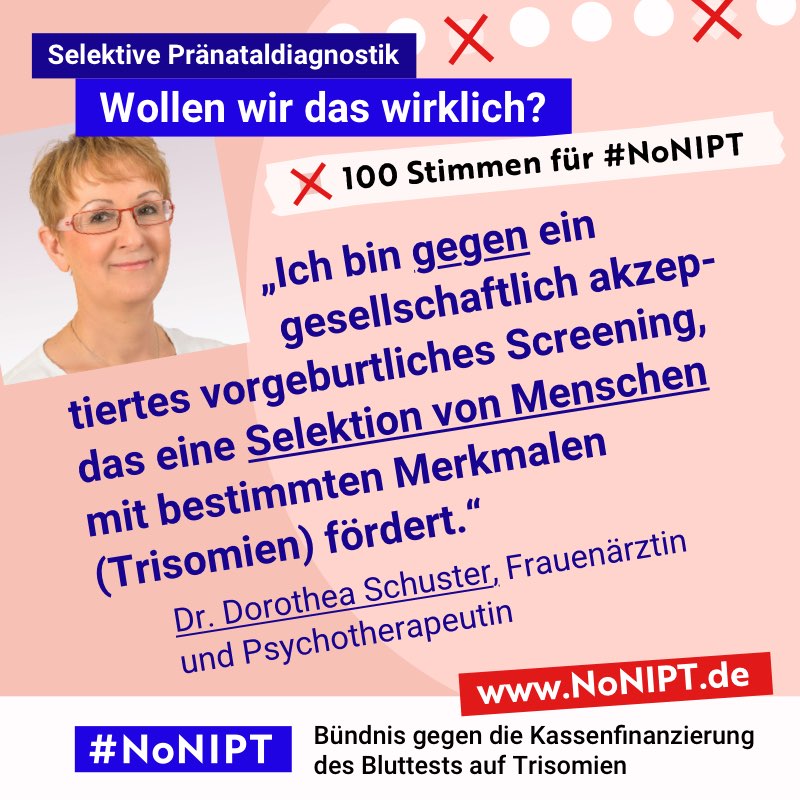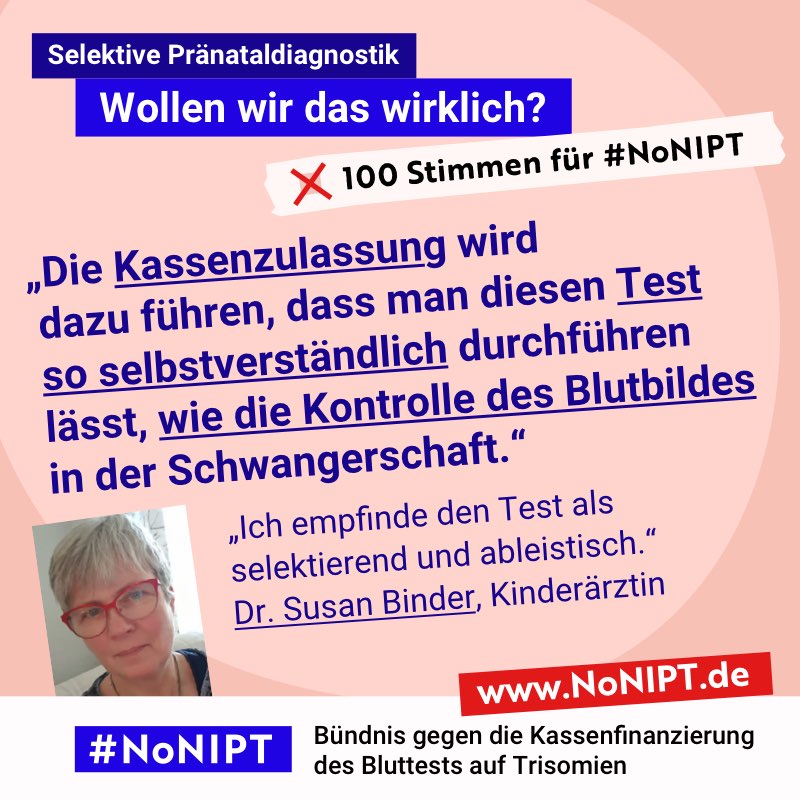Für das Bündnis #NoNIPT sprach Tina Sander im Januar 2022 mit dem Behindertenrechtsaktivisten Constantin Grosch über das diskriminierende Potenzial der Triage und der Kassenfinanzierung des Bluttests auf Trisomien.
Wir sprechen heute darüber, ob es Parallelen zwischen dem diskriminierenden Potenzial der Triage und der Kassenfinanzierung des Bluttests auf Trisomien gibt. Ohne die Dinge unzulässig zu vereinfachen: Denkst Du, es gibt ein gemeinsames Framework, was dahintersteht – ein gedankliches, gesellschaftliches, strukturelles?
Constantin Grosch: Ja, denn am Ende steht die Frage: Wie bewerten wir Leben? Letztlich liegt dem Ganzen leider doch genau diese Frage zugrunde. Bei der Triage besteht die Befürchtung, dass bestimmtes Leben in einer Krisensituation anders bewertet wird als das der anderen Personen. Und diese Frage stellt sich so auch beim Bluttest. Die gedankliche Grundstruktur ist in beiden Fällen letztlich, dass wir dem Menschenleben einen Nutzen zuschreiben und uns als Gesellschaft erlauben, davon ausgehend mit den Personen und ihren Leben unterschiedlich umzugehen. In der Folge scheint es, als hätten wir als Gesellschaft leider eine ziemlich genaue Vorstellung davon, welche Personen wir in Krisenzeiten in einer Triage benachteiligen würden und welche Menschen wir überhaupt erstmal leben, also geboren, sehen wollen werden. Dahinter steht in beiden Fällen unser Anspruch an die Person, welche Funktion sie in der Gesellschaft erfüllen soll.
Neun Menschen mit Behinderung haben letztes Jahr Verfassungsbeschwerde wegen der Gefahr einer Benachteiligung im Falle von Triage-Entscheidungen erhoben. Das Bundesverfassungsgericht hat am 28.12.21 entschieden, dass der Gesetzgeber unverzüglich dafür sorgen muss, dass Menschen mit Behinderung im Falle einer Triage geschützt werden.
Du bist einer der Beschwerdeführer und lebst selbst mit einer Behinderung – warst Du von dieser Entscheidung überrascht, wie bewertest Du sie?
Constantin Grosch: Die erste Reaktion war sehr positiv, weil wir ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hatten, dass das Bundesverfassungsgericht uns Recht gibt und zumindest einige Argumentationen sogar übernimmt. Das Gericht hat bestätigt, dass Menschen mit Behinderung der großen Gefahr der Diskriminierung im Gesundheitswesen unterliegen – nicht nur bezogen auf die Triage, sondern generell. Insofern war die erste Reaktion unseres Verfahrensbevollmächtigten, Herr Dr. Oliver Tolmein, ohne dass er jetzt die 50 Seiten gelesen hat, sehr positiv. Mittlerweile, nachdem jetzt einige Zeit vergangen ist und ich das ganze Urteil gelesen habe, bin ich und sind wir uns nicht mehr so sicher, ob wir so glücklich über das Urteil sind.
Warum?
Constantin Grosch: Weil das Urteil in einigen entscheidenden Punkten die bisherigen Regelungen unberührt lässt. Das Triage-Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht gilt jetzt als verfassungsrechtlich völlig unbedenklich. Die damit verbundenen Problematiken wurden vom Gericht kaum diskutiert. Wir haben das Gefühl, dass sich hier an diesem Punkt mit unseren Argumenten nur wenig auseinandergesetzt wurde. Das Gericht hat sich auch nicht mit alternativen Methoden auseinandergesetzt, also mit der Frage, ob eine Zufallsauswahl gerechter oder fairer und ethisch in Ordnung wäre, oder ein Dringlichkeitsprinzip, oder ein First-Come-First-Serve-Prinzip. Am Ende hat das Gericht der Politik eigentlich nur gesagt: Ihr müsst irgendwas regeln, ihr müsst halt aufpassen, dass Diskriminierung möglichst verhindert wird. Dem Gericht war dabei eine Sache besonders wichtig: Die letzte Entscheidung liegt beim Arzt. Unser Ziel wäre aber gewesen, dass staatlich überprüfbare Regeln geschaffen werden und wir wollten eine Diskussion erreichen, ob überhaupt die klinische Erfolgsaussicht das richtige Kriterium ist. Und da ist das Verfassungsgericht drüber hinweggegangen und hat gesagt: passt schon.
Das BVerfG hat die Entscheidung also wieder in den ärztlichen Deutungshoheitsbereich verwiesen.
Bislang orientierten sich Ärzt:innen beim Thema Triage an Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) – warum hast Du dich durch deren Leitlinien nicht ausreichend vor Diskriminierung geschützt gefühlt?
Constantin Grosch: Das hat zwei Aspekte: Der eine ist das Grobkriterium der klinischen Erfolgsaussicht: Die Frage danach, wer behandelt wird, machen wir davon abhängig, von welcher Person wir erwarten, dass sie möglichst gut diese Behandlung übersteht. Wir hantieren mit Erwartungen, die sich aus Wahrscheinlichkeiten und statistischen Zahlen speisen und auf dieser Basis Individuen mit bestimmten Merkmalen pauschal schlechter stellen, zum Beispiel Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen.
Der zweite Aspekt liegt im Detail: Die DIVI hat gefragt: Wie erheben wir eigentlich die Erfolgsaussicht? Dann hat sie dafür u.a. Kriterien herangezogen, die für ganz andere Aufgaben entwickelt wurden, z.B. die sogenannte Gebrechlichkeitsskala, die eigentlich entwickelt worden ist, um sehr schnell einzusortieren, wie viel Unterstützung eine Person braucht. Und das nutzen wir jetzt als ein Kriterium um die Erfolgsaussichten einer Behandlung abzuschätzen. Dafür ist diese Skala nicht gemacht.
…steht da nicht sogar explizit drin, dass die Skala nicht für Menschen mit Behinderung entwickelt wurde?
Constantin Grosch: Ja, selbstverständlich hat auch die DIVI in ihrem Papier an einer Stelle stehen, dass Menschen mit Behinderungen natürlich nicht diskriminiert werden dürfen. Aber es steht halt im Kleingedruckten und nicht im Prüfschema.Das ist aber gefährlich bei einem Katalog, aus dem ein Schema entwickelt werden soll, das im Ernstfall schnell abzuarbeiten sein muss. Die Ärzte müssen in der Notsituation ja schnell entscheiden, wen behandeln sie und wen nicht. Hier hat das Verfassungsgericht auch festgestellt: Gerade für ein solches Schema müssen wir besonders aufpassen, dass es nicht Menschen, die irgendein Vorurteil im Kopf haben, dazu bringt, etwas anzukreuzen, was nicht richtig ist. Und deswegen haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass dort so eine Gebrechlichkeitsskala drin ist, bei der dann irgendwie angekreuzt wird, der kann sich nicht allein bewegen, dann kriegt er eine schlechte Bewertung. Denn das führt eben dazu, dass Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen und Vorerkrankungen per se ein schlechtes Scoring bekommen.
Den Punkt fand ich bemerkenswert, dass der Beschluss des BVerfG anerkannt hat, dass Vorurteile und Stereotype ärztliche Entscheidungen beeinflussen können und Menschen mit Behinderung damit der Gefahr von Diskriminierung ausgesetzt sind. Das ist doch auch eine Genugtuung, oder?
Constantin Grosch: Das stimmt, das ist wirklich die gute Seite des Urteils. Sie haben der DIVI ja auch nochmal einen mitgegeben, indem sie sagen, gerade das Schema, dass die da aufgebaut haben, öffnet Tür und Tor für Diskriminierung, das steht wörtlich so im Urteil drin. Ich sag mal, eine krassere Ohrfeige kannst Du nicht bekommen als Organisation, die selbst sagt, wir wollen ja gar nicht diskriminieren.
Unser Problem haben sie bestätigt, haben aber dann meiner Meinung nach beim Beschluss nicht mehr die Courage gehabt zu sagen, daraus resultiert etwas Starkes. Sondern sie haben dann nur noch gesagt: Wir sehen ein, wir müssen irgendwie tätig werden als Gesellschaft, wir dürfen nicht sehenden Auges Diskriminierung akzeptieren – aber wie wir das machen ist nicht mehr unsere Aufgabe, liebe Politik, kümmert euch.
Ich versuche mal überzuleiten zu dem, was gemeinsam ist gedanklich hinter der Kassenfinanzierung des Bluttests auf Trisomien und der Triage. Unser Bündnis #NoNIPT kritisiert an der Kassenfinanzierung des Bluttests auf Trisomien, dass diese Entscheidung im Kern ebenso auf stereotypen und vorurteilsbehafteten Vorstellungen von Menschen mit Behinderung gründet. Dass darin eine grundsätzliche Lebenswertbewertung, in diesem Fall von Menschen mit Trisomien liegt, die damit als vermeidbar und zu vermeidend markiert werden. Das Gesundheitssystem nimmt an dieser Stelle gewissermaßen eine Vorbewertung vor. Ist so die vielbeschworene freie und unabhängige Entscheidung Schwangerer überhaupt möglich?
Constantin Grosch: Nein, an die freie Entscheidung glaube ich nicht. Wir sprechen hier von Situationen, in denen Menschen sowohl emotional als auch vielleicht körperlich sind, die sie in höchstem Maße fordern. Sie suchen Hilfe bei Personen, denen wir als Ärzten enormes Vertrauen entgegenbringen. Dadurch werden Ärzte zu einer Instanz bei Fragen, in denen sie unter Umständen den gleichen Vorurteilen unterliegen wie die Gesellschaft im Allgemeinen. Wir haben das gerade in Tuttlingen erlebt, wo z.B. die Pflegeeinrichtungen aufgefordert wurden, mit den Angehörigen und den Betroffenen zu sprechen, ob sie sich nicht schon mal freiwillig „dafür entscheiden“, nicht mehr behandelt zu werden. Mit der Argumentation: Seid mal solidarisch mit der Gesellschaft. In der Schwangerschaftsvorsorge erleben wir, dass Ärztinnen und Ärzte den Eltern erzählen, wie schlimm das Leben für das dann geborene Kind sein könnte. Genauso wie bei alten Menschen vor aufwendigen Behandlungen gewarnt wird, das Ergebnis könne Pflegebedürftigkeit sein. Dahinter steht natürlich der Gedanke, man solle vorher überlegen, ob man wirklich behandelt werden will. Und bei den werdenden Eltern: Entscheidet Euch bitte gegen dieses Kind. Am Ende schwingt auch immer mit: Denkt doch bitte an den Nutzen für die Gesellschaft. Denkt doch auch daran, was kostet uns das als Gesellschaft, dass dort ein behindertes Kind geboren wird. Denkt doch bitte daran, dass ihr die Plätze einem jüngeren Menschen bei der Triage wegnehmt. Wird vielleicht so nicht ausgesprochen, aber mindestens wird es unterschwellig mitkommuniziert. Also von daher sehe ich da extrem viele Parallelen und ich glaube auch, dass man in der Situation, keine freie Entscheidung treffen kann.
Du hast jetzt sehr auf die Beratung abgezielt, die im ärztlichen Kontext stattfindet, die häufig problematisch ist. Wir kritisieren vor allem die Kassenfinanzierung als Signal an die Versicherten: Was die Kasse zahlt, das ist gut, das ist sinnvoll, das ist verantwortungsbewusst, das wahrzunehmen.
Wir sehen hier eine hochproblematische gesellschaftliche und strukturelle Diskriminierung im Kontext der Schwangerenvorsorge. Warum wird diese Position leicht als Kritik an individuellen Entscheidungen Schwangerer fehlgedeutet und löst damit eine große Abwehr aus?
Constantin Grosch: Durch die Kassenfinanzierung sagtdie Gesellschaft, uns ist das wichtig, wir geben dafür Geld aus. Eine Gesellschaft gibt immer Geld für etwas aus, von dem sie glaubt es ist wichtig und hat eine Priorität und ist sinnvoll. Und der Test hat dann am Ende nun mal zum Zweck, dafür zu sorgen, dass keine Menschen mit Trisomie geboren werden. Und durch die Finanzierung sagen wir als Gesellschaft, das ist uns wichtig, dass keine Menschen mit Trisomie 21 geboren werden.
Das bestreiten aber alle. Alle sagen: Nein, auf keinen Fall. Wir wollen nur eine informierte Entscheidung Schwangerer ermöglichen. Niemand gibt zu, dass das gewollt ist. Das ist ja das Schwierige.
Constantin Grosch: Wir sind ja jetzt genau an der Frage, welche Parallelen gibt es eigentlich. Die ganze Diskussion hatten wir bei der Tuttlingen-Frage auch. Als wir das skandalisiert haben, wurde uns rückgemeldet: Warum regt ihr euch eigentlich auf? Wir wollen doch nur Menschen darüber informieren und aufklären, dass sie z.B. eine Patientenverfügung machen und sagen, sie wollen eben nicht behandelt werden. Was seht ihr daran kritisch? Kritisch ist, dass ihr das per se erstmal nur bei Alten- und Senioren- und Behinderteneinrichtungen macht und das in den Kontext der Pandemie stellt – das ist das Problem. Wenn wir jetzt sagen würden in Deutschland: Egal, welche Tests es gibt, egal auf welche Krankheiten – jeder Bürger hat das Recht sich jeden Test bezahlen zu lassen von der Krankenkasse – und dann ist eben auch der NIPT auf Trisomien dabei. Ok, könnte man diskutieren. Die Kassenfinanzierung wird aber nur für den Test auf die drei Trisomien eingeführt.
Was ich jetzt spannend finde, Du hast ja selbst gesagt, an der Stelle hat das BVerfG eine Leerstelle gelassen. Und genauso ist es ja im Umgang mit diesen ganzen vorgeburtlichen Tests. Wie kann denn sowas geregelt werden, dass zum einen das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung ernst genommen wird – aber gleichzeitig diese Abwertung vermieden würde. Noch eine andere Idee, außer zu sagen – wir zahlen alles oder nichts?
Constantin Grosch: Die Alternative kann natürlich nicht ernsthaft sein, wir testen auf alles oder wir testen auf gar nichts. Sondern die Frage müsste eigentlich sein: Ist das eine medizinische Frage? Ist das eine Testung auf eine medizinische Frage oder ist das eine Frage, die eher aus gesellschaftlichen Gründen herrührt. Aus einer medizinischen Perspektive gibt es keine Debatte darüber, ob eine Person mit Trisomie 21 lebensfähig ist.
Als ein Behindertenaktivist nehme ich mir das Recht heraus, zu überlegen, was denn die tatsächlichen Gründe dahinter sein mögen. Wenn es das große Interesse an der psychischen Gesundheit der Mutter wäre, würden wir ja eher die Frage stellen: Wie können wir besser unterstützen? Wie gehen wir hinterher mit dem Kind um? Es ist für mich eine Asymmetrie zu sagen, wir vermuten, dass es eine psychische Belastung ist, ein Kind mit einer Behinderung zu bekommen – und unsere Lösung dafür ist jetzt ein Test. Durch den Test selbst wird ja erst einmal die psychische Belastung nicht geringer.
Weil die eigentliche Frage ja nicht ist, ob wir einen Test machen, sondern die eigentliche Frage kommt danach: bekomme ich das Kind oder bekomme ich es nicht. Mit der Kassenfinanzierung sagt die Gesellschaft also: Wir wollen euch die Möglichkeit schaffen, ein behindertes Kind abzulehnen, wir wollen, dass ihr diese Entscheidung treffen könnt.
Euer Prozessvertreter, der Menschenrechtsanwalt Oliver Tolmein hat in einem aktuellen Kommentar im Tagesspiegel darauf hingewiesen, dass die Herausforderung jetzt darin liegt, die grundsätzlichen Probleme des nicht-inklusiven Gesundheitssystems anzugehen. Aus unserer Sicht begegnen sich genau hier das Thema der Triage und der Umgang mit vorgeburtlichen genetischen Tests. Wie siehst Du das?
Constantin Grosch: Ich glaube, dass wir gar nicht in diese langfristige Betrachtung kommen, wenn wir die kurzfristigen „Lösungen“ nutzen. Natürlich sollten wir uns eigentlich fragen: Warum haben wir Ressourcenknappheit im Gesundheitswesen, warum gibt es Vorurteile gegenüber behinderten Menschen. Diese Probleme können aber nur langfristig gelöst werden. Nur das hilft uns jetzt gerade nicht weiter.
Die Gesellschaft macht es sich leicht und widerspricht sich gleichzeitig. Sie erkennt zwar vordergründig die Probleme an und gibt die Absichtserklärung ab, langfristig die nötigen Ressourcen bereitzustellen und ein anderes Bild von Behinderung anzunehmen. Kurzfristig löst sie dann aber die Probleme auf eine Weise, dass wir nie in die langfristige Perspektive eintreten. Langfristig versprechen wir etwas, dem wir kurzfristig mit genau der gegensätzlichen Antwort begegnen. Damit müssen wir die Gesellschaft konfrontieren: Wenn ihr das langfristige Ziel nur als ein Versprechen formuliert, aber als kurzfristige Lösung genau das Gegenteil entscheidet – nämlich bei der Triage trotzdem Menschen mit Behinderung diskriminiert und beim NIPT bewirkt, dass Menschen mit Trisomie nicht geboren werden, dann muss man schon die Frage stellen: Was ist denn jetzt euer eigentliches Ziel? Oder wo seid ihr denn jetzt ehrlich und wo nicht? Wenn wir sagen: Natürlich wollen wir, dass Menschen mit Trisomie in Deutschland leben, dann müsste doch die Antwort sein: Dann müssen wir auch kurzfristig dafür sorgen, dass die auch geboren werden.
Link-Tipps von #NoNIPT:
https://www.grosch.co/
https://nonipt.de/news/100-stimmen-fuer-nonipt/constantin-grosch-1-von-100-stimmen-fur-nonipt/