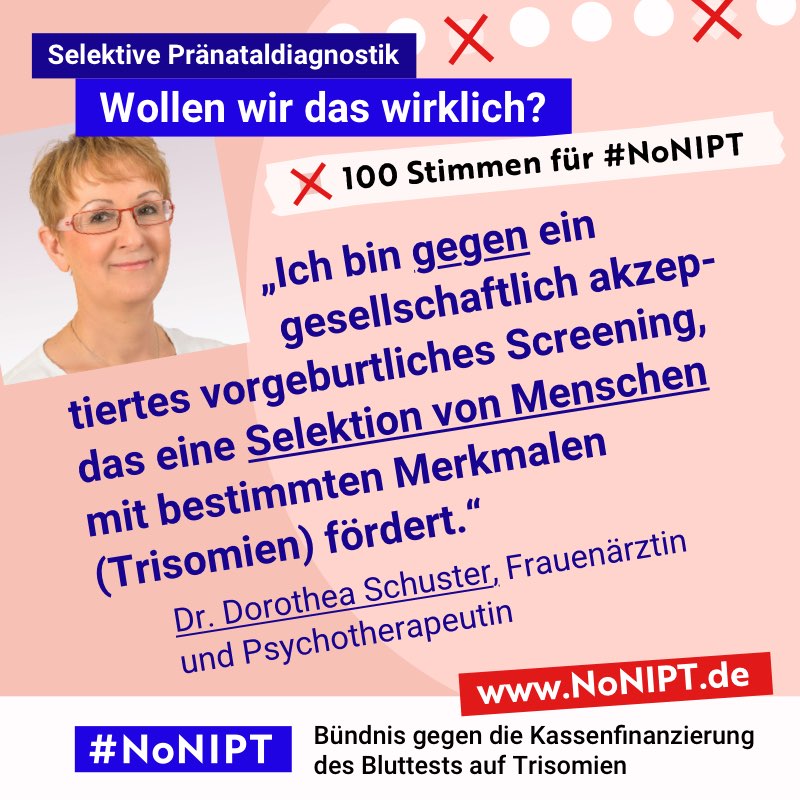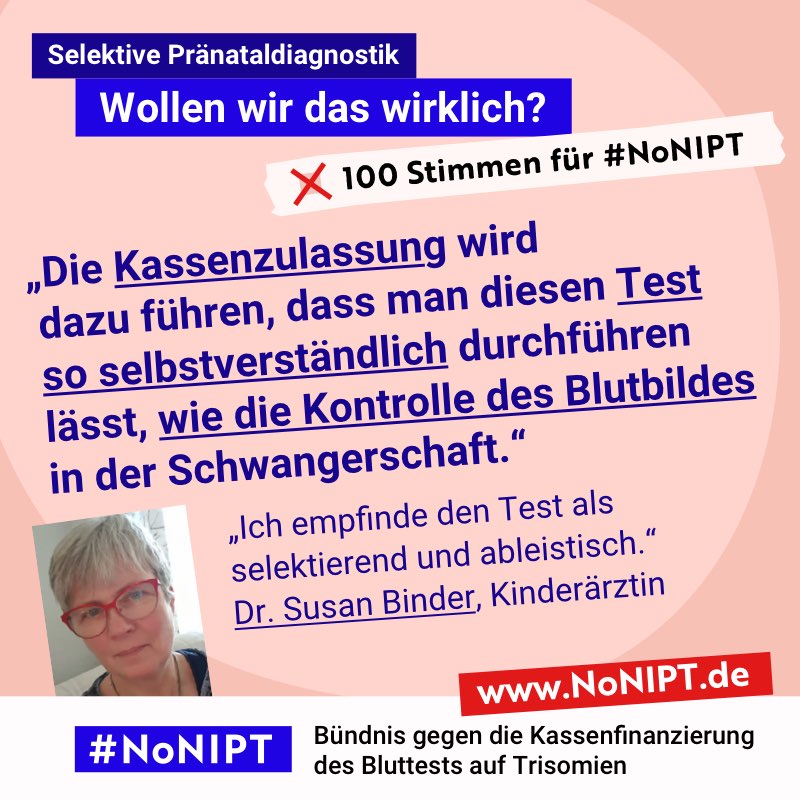Der Einsatz selektiver Pränataldiagnostik ist der zum Scheitern verurteilte Versuch, das gesellschaftliche Problem ableistischer Diskriminierung durch Technologie zu lösen – tatsächlich beruht er auf diesem und reproduziert es. Der NIPT setzt damit die historische Kontinuität der Pathologisierung und Tabuisierung von Behinderung fort.
Bei der Debatte um selektive Pränataldiagnostik und anderen Verfahren assistierter Reproduktion ist es enorm wichtig, einen Blick auf die Verschränkungen von sexistischen und ableistischen Diskriminierungsformen zu werfen, die in diesem Zusammenhang wirken.
Die Pathologisierung und Normierung von Körpern und bevormundende Verfahrensweisen durch die Lebenswissenschaften und medizinische Praxis haben bereits eine jahrhundertelange Geschichte. Dies betrifft die Medikalisierung und Exklusion von Menschen mit Behinderung genauso wie den Paternalismus gegenüber Schwangeren im Gesundheitssystem. Das darf in politischen Diskussionen nicht gegeneinander ausgespielt werden! Die Forderung nach reproduktiver Selbstbestimmung darf nicht bei Pro-Choice-Standpunkten aufhören; vielmehr muss der Kampf für reproduktive Gerechtigkeit intersektional geführt und die Komplexität ethischer Fragen mitgedacht werden. Das bedeutet im Kontext der Schwangerschaftsvorsorge vor allem, dass die Verantwortung für die Entscheidung für oder gegen den NIPT nicht individualisiert werden darf, sondern struktureller Ableismus als gesellschaftliches Problem ernst genommen und als solches angegangen werden muss.
Die Kategorisierung der Behinderung als etwas „Abweichendes“ – durch selektive Pränataldiagnostik als medizinisches und biologisches „Problem“ gerahmt – verschleiert die strukturelle Diskriminierung, die diesen Praktiken erst ihre auf mehrheitsgesellschaftlicher und realpolitischer Ebene weitestgehend unhinterfragte Legitimität verleiht. Die Erweiterung des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung durch die Aufnahme des NIPT auf Trisomien und die nur marginal geführte ethische Debatte zeigen diesen Normalisierungsprozess in aller Deutlichkeit.
Reproduktive Gerechtigkeit muss in diesem Kontext Entscheidungsautonomie von Schwangeren über ihre Körper bedeuten, aber auch die gesellschaftliche Gewährleistung der Möglichkeit, eine Schwangerschaft und ein Leben mit dem Kind frei von medizinischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Zwängen zu gestalten. Essenziell dafür ist eine medizinische Versorgung von Schwangeren, die sich an deren Bedürfnissen orientiert, statt durch paternalistische oder normierende Behandlungen die historische Kontinuität der Reproduktion struktureller Diskriminierung durch Medizin und Wissenschaft fortzusetzen. Die Praktiken selektiver Pränataldiagnostik widersprechen diesem intersektional-feministischen Anspruch in jeder Hinsicht.
Luise Meck ist Studentin der Soziologie und Philosophie.
Link-Tipp von #NoNIPT:
https://repro-gerechtigkeit.de/de/manifest/